Wie lässt sich das Immunsystem gegen Lymphome richten?
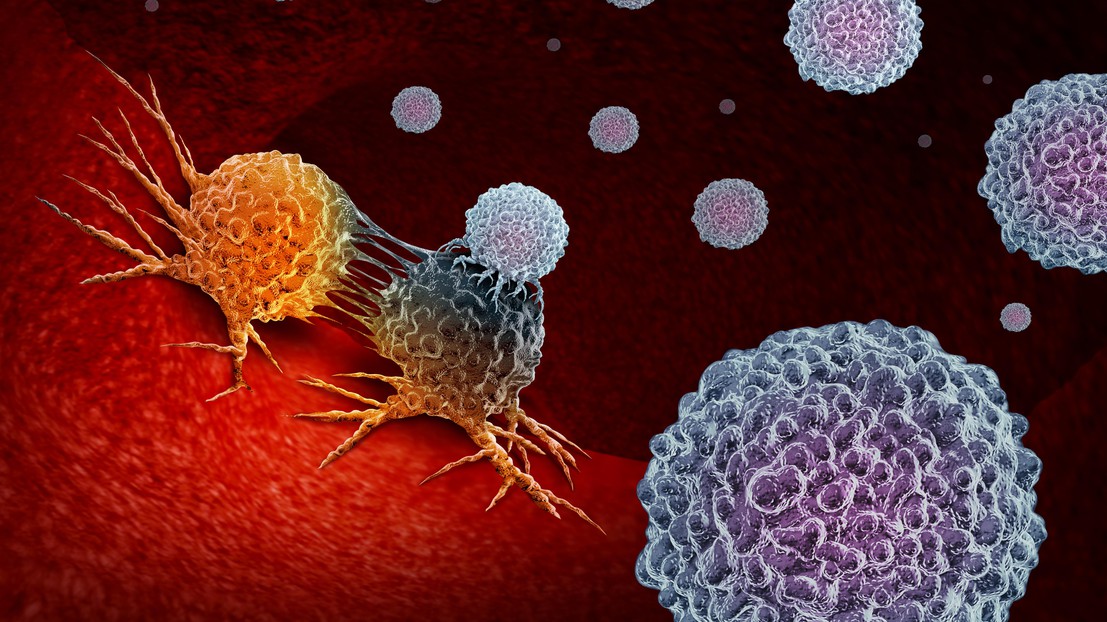
Illustration von Immunzellen, die Krebszellen angreifen (iStock)
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen wichtigen Mechanismus gefunden, den Tumorzellen nutzen, um das Immunsystem in die Irre zu führen und nicht entdeckt zu werden. Eine neue Behandlungsstrategie besteht nun darin, auf diesen Mechanismus abzuzielen, um Krebsarten wie das Non-Hodgkin-Lymphom zu bekämpfen.
Das Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) ist eine Krebsart, die in den Lymphknoten entsteht und die als B-Lymphozyten bezeichneten weissen Blutkörperchen des Abwehrsystems schädigen. Sie lösen eine unkontrollierte Vermehrung und die Bildung von Tumoren in den Lymphknoten, der Milz und anderen Organen aus. Gemäss den Zahlen der American Cancer Society wird 2020 bei rund 80 000 Menschen ein NHL diagnostiziert, und 20 000 werden daran sterben.
Die Immuntherapie stellt zurzeit eine der vielversprechendsten Behandlungen für Krebspatientinnen und -patienten dar. Im Gegensatz zur Strahlen- und Chemotherapie soll bei der Immuntherapie das Abwehrsystem des Patienten «aktiviert» werden, damit es den Tumor angreift und zerstört. Oft verändern sich jedoch Tumore wie auch das NHL, damit sie vom Immunsystem nicht entdeckt werden können, oder sie nutzen Wechselwirkungen mit Abwehrzellen, um zu wachsen.
Immunsystem ablenken
Ein Forschungsteam der EPFL unter der Leitung von Elisa Oricchio hat einen der Mechanismen entdeckt, die das NHL nutzt, um das Immunsystem abzulenken. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben festgestellt, dass bestimmte Patientinnen und Patienten mit NHL eine mutierte und überaktivierte Form eines Proteins namens Cathepsin S aufweisen. Dieses ist dafür verantwortlich, andere Proteine in kleine Fragmente zu zerlegen, die anschliessend an die Oberfläche von Tumorzellen gelangen. Diese Fragmente dienen dann als Kommunikationskanal zwischen dem Krebs und den Abwehrzellen.
«Wenn das Cathepsin S aktiv ist, interagieren die Krebszellen mit den als CD4+-T-Lymphozyten bezeichneten Abwehrzellen, die dem Tumor beim Wachsen helfen, während sie einen gewissen Abstand zu den CD8+-T-Lymphozyten halten, die den Tumor angreifen und zerstören würden», erklärt Elie Dheilly, einer der Hauptautoren der Studie.
Nach der Aufdeckung dieser heimtückischen Beziehung zwischen Krebszellen und T-Lymphozyten wollten die Forscherinnen und Forscher das Cathepsin genetisch eliminieren, um seinen Einfluss auf das Tumorwachstum zu verstehen.
Einfachere Identifizierung von Tumorzellen
Die Hemmung von Cathepsin S führte zu einer Reduktion des Tumorwachstums, indem die Kommunikation mit den T-Zellen umgedreht wurde: Jetzt griffen die CD8+-Lymphozyten den Tumor an, während die CD4+-Lymphozyten auf Abstand gehalten wurden. Dieses Ergebnis konnte dank der sogenannten «Antigendiversifizierung» erzielt werden. Diese führt zu einer anderen Art von Fragmenten, die den T-Lymphozyten helfen, die Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören.
«Wir sind der Auffassung, dass Cathepsin S ein wichtiges therapeutisches Ziel sein könnte», sagt Elisa Oricchio. «Die Antigendiversifizierung stellt eine interessante Behandlungsstrategie dar, um die Immunogenizität im Zusammenhang mit Tumoren zu verstärken und das Anschlagen von Immuntherapien bei Lymphomen und vielleicht auch anderen Tumorarten zu verbessern.»
Im Rahmen dieser Studie entwickelte Hauptautorin Elena Battistella eine neue Bildgebungstechnik, um die Aktivität von Cathepsin S zu messen. Dank dieser Methode konnten Elisa Oricchio und ihr Team neue Inhibitoren ermitteln und weiterentwickeln, die genutzt werden könnten, um die Behandlung von NHL-Patientinnen und -Patienten zu verbessern.
Das Labor von Prof. Oricchio ist Teil des Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer (ISREC) der Faculté des sciences de la vie de l’EPFL. Das ISREC (EPFL) ist Teil des Centre suisse du cancer – Arc lémanique (SCCL), einer multidisziplinären Gruppe für grundlegender, translationaler und klinischer Krebsforschung.Gründungsmitglieder der SCCL sind das Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), die Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), die Universitäten von Lausanne (UNIL) und Genève (UNIGE) sowie die l’EPFL.
Andere Mitwirkende
- Centre suisse du cancer – Arc lémanique
- Université de Lausanne
- Institut suisse de bioinformatique
- Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer
- Centre hospitalier universitaire vaudois
- Centre for Lymphoid Cancer, BC Cancer Agency
- Institut de bioingénierie de l’EPFL
- Plateforme technologique d’histologie
- Université d’Ulm et centre médical de l’université d’Ulm
- Princess Margaret Cancer Center
Fondation ISREC
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Ligue suisse contre le cancer
Fondation Emma Muschamp
Fondation Aclon
Elie Dheilly, Elena Battistello, Natalya Katanayeva, Stephanie Sungalee, Justine Michaux, Gerben Duns, Sarah Wehrle, Jessica Sordet-Dessimoz, Marco Mina, Julien Racle, Pedro Farinha, George Coukos, David Gfeller, Anja Mottok, Robert Kridel, Bruno E. Correia, Christian Steidl, Michal Bassani-Sternberg, Giovanni Ciriello, Vincent Zoete, Elisa Oricchio. Cathepsin S regulates antigen processing and T cell activity in Non-Hodgkin Lymphoma. Cancer Cell, 23 avril 2020. DOI: 10.1016/j.ccell.2020.03.016